Früher war vieles besser: da gab es ein „E” und ein „U”. Streng getrennt nach „ernsthafte Kunstausübung” oder „purer Unterhaltung”. Intellektualität & Klassik – Emotionalität & (Nacht) Leben. Doch dann kamen die Neuen Dilletant:inen und machten dem „e” ein „u” und dem „u” ein „e” vor. Danach war es vorbei mit der Wirkungsforscher:innen Erfassbarkeit. Lange war Ruhe. Jetzt kommt wieder Bewegung: die Kulturwissenschaft begibt sich wieder auf der Suche nach erfassbaren Denkmustern, um die neue, disperate Multikultur zu begreifen. Ein Forschungsgegenstand.
Selbstverständlich kann man sich die Frage stellen, warum es sich lohnen sollte, Muster für künstlerische Ausdrucksformen und Publikumsverhalten zu finden. Diese Frage stellte sich im kunstsoziologischen Kontext aber auch schon Anfang der 1980er Jahre. Damals begannen sich Normen und Konventionen zu ändern. Danach fielen die Grenzen. Und es kam die Öffnung. Kulturpolitik und Kunstkritik haben es mit neuen Realitäten, perforierten Genre-Grenzen und einer Gesellschaft zu tun, die sich nicht mehr an die Muster der Rezeptionstheorie hält. Status Quo 2020.
Die Welt ist weiter in Bewegung. Beschleunigt durch die Pandemie werden neu erlebte Defizite, geänderte Vorstellungen und eine angepasste Kommunikation das gesellschaftliche Miteinander prägen. Kulturschaffende sind auf der Suche nach gemeinsamen Plattformen, um ihre in Echokammern vereinzelte Stimmen wieder zu bündeln. Aktuelle Förderprogramme zeigen, dass kulturelle Angelegenheiten kaum noch einen Platz auf der politischen Agenda finden.
Das Fehlen des öffentlichen Raums führt dazu, dass digitale Treffpunkte die technische Entwicklung beschleunigen und damit Interaktion und Kommunikation nachhaltig verändern. Für Kommunikator:in wie Rezipient:in gleichermaßen. Was sich aktuell in nie dagewesener Deutlichkeit zeigt: ist erlebbare Kultur abgeschaltet, wird dies als Mangel empfunden. Das sollte Motivation genug sein, Argumentationscluster zu finden, um Kulturpolitik auf ihre gesellschaftliche Verantwortung hinzuweisen und Zunkunftsmodelle des Handels und Gestaltens zu entwickeln.
Mit wissenschaftlichen Methoden zum praxisrelevanten Handeln
Das Problem: wo kann die deskriptive Wissenschaft mit der Erforschung der neuen Zustände ansetzen, um die benötigten Grundlagen, Denk- und Handlungsmuster disperater Teilwirklichkeiten, die in ihrer Summe das aktuelle Kulturverständnis ergeben, zu erfassen? Mit den Mitteln einer empirischen Sozialwissenschaft? Mit Deskription? Oder der philsophischen Diskurskultur?
In Zeiten des Wandels ist eine Methodik zu entwicklen, die keiner Schule mehr vertraut und innerhalb dieser Schulen nach geeigneten Methodiken sucht und diese kombiniert. Zudem sollte man nicht aktuelle Strömungen, die gerade erst als „angewandte Wissenschaften” erschlossen werden außer Betracht lassen. Mit dieser Kombination lassen sich neue Perspektiven eröffnen, die dabei helfen, die sich gerade erst neu zusammensetzenden kulturellen Handlungsmuster und Stile zu durchleuchten.
Was Freiheitsrechte in der Pandemie mit kultureller Entwicklung zu tun haben

Da es während der Pandemiebekämpfung in erster Linie um Gesundheit, Versorgung, Bildung und Wirtschaft geht sowie um die Diskussion der individuellen Freiheitsgrade, bleibt kaum noch Platz für den kulturellen Diskurs. Dieser wird – auf Basis der politisch getroffenen Priorisierung – hintangestellt. Diese Ausdifferenzierung in Kategorien des Notwendigen wird zu einer Ausdünnung und Verschiebung des Kulturlebens in der Zukunft führen.
Folgender Text, der sich mit dem Begriff der Freiheit aus staatsrechtlicher Sicht beschäftigt, lässt sich im Ergebnis auch auf Kulturpolitik transferieren:
„Dass Ausdifferenzierung eine Form von Freiheit ist, obwohl beide Kategorien in der Theorie zu selten zusammengebracht werden, hat sich in der Krise bestätigt … Auch wurde sichtbar, dass der Gebrauch von Freiheit ein unlösbares Problem der Verzeitlichung hat. Wer seine Freiheit in der Gegenwart nutzt, kann größere Unfreiheit in der Zukunft produzieren. Aber das ändert nichts daran, dass Freiheit, die in einem Augenblick nicht genutzt wird, unwiederbringlich verloren ist. Gegenwärtige Freiheit mag sich zugunsten zukünftiger Freiheit verschieben lassen, nachholen kann man die so verschobene Freiheit nicht.
Die Relevatisierung individueller Freiheit durch die Krise ist dabei nicht einfach ein Werk politischer Herschaft. Diese formalisiert nur den ungeheueren Umstand, dass jedweder körperliche Nähe als Bedrohung verstanden werden kann, die sowohl indivivuell als auch systemisch wirkt. Aus diesem Grund wir man die nie ganz falsche, aber dewegen häufig triviale Feststellung relativieren müssen, dass die Reaktion auf den Virus nicht sachlich erzwungen, sondern politisch ist. Sie ist zutreffend, weil wir es mit über die Herrschaftsorganisation vermittelten und in eine Form gebrachten Maßnahmen zu tun haben, die immer auch anders gestaltet sein könnten. Sie ist unzutreffend, weil es nicht um Gestaltung geht, sondern um den Schutz des bedrohten Status der öffentlichen Gesundheit. Durch eine Bürokratie, die so nur unter der Bedingung eines großen informalen Konsenses operieren kann. Die politischen Spielräume, die diese Bedrohung lässt, das zeigt der Vergleich der Maßnahmen in verschiedenen Ländern, erscheinen gering. Die eintretenden sozialen Folgen dagegen sehr unterschiedlich. Diese Unterschiede sind freilich ihrerseits das Ergebnis unterbliebener politischer Gestaltung, namentlich des Gesundheitswesens, aber allgemein des Umgangs mit sozialer Ungleichheit vor der Krise.
Hier bestätigt sich, dass die beträchtlichen Gefahren präventiven Handelns für die Freiheit freier Gesellschaften auch nicht überschätzt werden dürfen. Weil der Mangel an Prävention maximale Unfreiheit stiften kann. Zugleich funktionierten die Regeln, die zur Bekämpfung der Seuche gewählt wurden, solange besonders gut, wie sie streng formell keine Ausnahmen kannten. Obwohl die Maßnahmen nie alle gleich trafen, schuf die Form der allgemeinen Regel in der Gemeinsamkeit der Unfreiheit ein kurzlebiges, substanzielles politisches Band. Als diese Regeln auf Möbelhäuser nicht mehr, auf Kindergärten aber weiterhin Anwendung fanden, wechselten sie für alle ihre Bedeutung. Die Zwangssolidarität der Betroffenheit verflüchtigte sich. Diese Zwangsolidarität ist ohnehin nur die sichtbare Seite der vielfach unsichtbaren Ungleichheit, die durch die Krise verschärft wurde. (aus: Christoph Möllers, Freiheitsgerade, Suhrkamp, 2020).
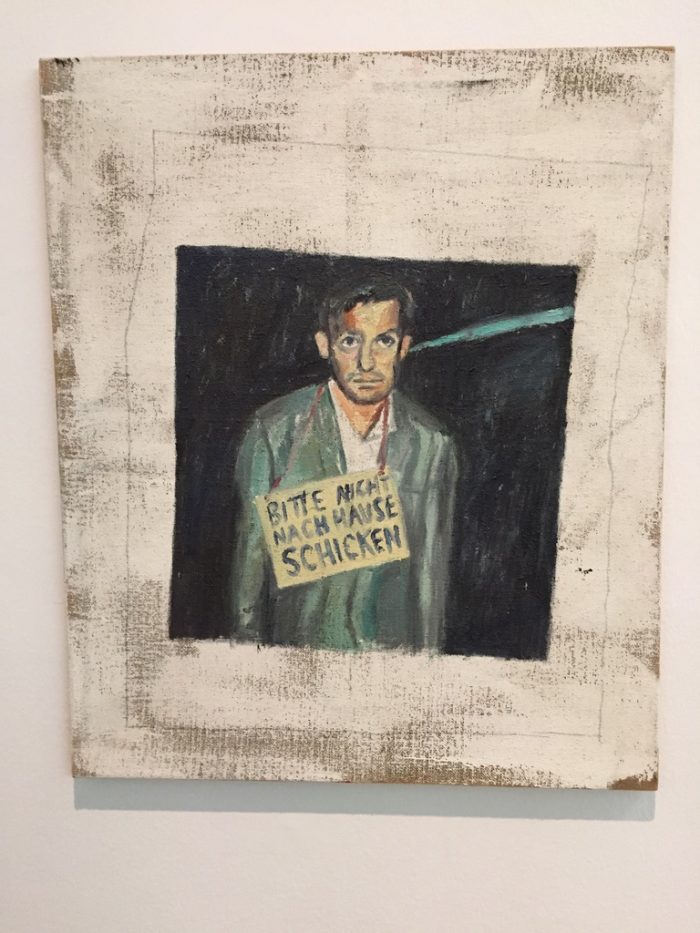
Nimmt man diese Argumentation und übersetzt sie zur Übersetzung des kultuellen Status Quos, versteht man, warum nur noch gesellschaftlich etablierte – und geförderte – Kultureinrichtungen und Künstler:innen in der aktuellen Krise besser gestellt werden. Dieser politische Pragmatismus zur Erhaltung des gesellschaftlichen Konsenses wird zu einer deutlichen Veränderung der Kultur nach der Pandemie führen. Es ist zu befürchten, dass es so zu einem weiteren Verlust von Entwicklungs- und Experimentierräumen kommt wird und diese dann nur noch durch private und ehrenamtliche Initiativen ermöglicht werden. Dadurch verlieren sie an öffentlicher Aufmerksamkeit und Akzeptanz und verschwinden in der „Off-Kultur” (Offspaces, Off-Theater, Subkultur, in denen Konzerte, Performatives und Soziokultur stattfindet, werden als Off-Kultur bezeichnet). Eine disperate Kultur ist im Entstehen.
Der Teil des disperaten Publikums, der sich von der kulturpolitischen Agenda ausgeschlossen fühlen wird, wird neue Bedürfnisse artikulieren und diese auch durchsetzen versuchen. Und das nicht im Rahmen der normativen kulturpolitischen Regeln, die für diesen Teil von Künstler:innen und Publikum ihre Bedeutung verlieren werden. Diese Entwicklung lässt sich bereits jetzt erahnen: Streamingdienste, Videoplattformen und digitale Präsentationsformate führen heute schon dazu, dass sich Publika singularisieren. Die Schnittmenge dieser bereits differenzierter Publika, Genres und Ausdrucksformen wird durch die Distanzierungsforderung der pandemischen Regeln weiter abnehmen. Ziel einer zukünftigen Kulturpolitik in der Post-Corona-Ära sollte aus sozialgesellschafter Sicht sein, diese Grenzziehungen aufzulösen, um Partikularinteressen in ein gemeinsames Ganzes zusammenführen zu können.
Das Projekt: Definition der disperaten Kultur und Formulierung eines Aktionsplans zur Zusammenführung unterschiedlicher Interessen auf Plattformen der gesellschaftlichen Kommunikation, um dadurch Innovation, Ideen- und Konzeptpartizipation über Genre- und Publikumsinteressen hinweg (wieder) zu ermöglichen.
Diese Entwicklung ist nur bedingt den demokratisch legitimierten Entscheidungsgremien anzulasten, Deren vorderste Aufgabe ist es, gesellschaftliche Ordungssysteme zu manifestieren. Diese Manifestationen werden behördlichen Strukturen übergeben, deren Aufgabe es dann ist, mittels Genehmigungen und Förderungen Kulturentwicklung zu begleiten. In letzter Konsequenz profitieren wiederum Institutionen, die in und mit diesen behördlichen Vorgaben arbeiten können und die bereits Unterstützung erhalten. Transformationsprozesse können in der Regel durch demokratisch legitimierte Entscheidungsgremium, die immer auf Konsens und Erfahrungen aus der Vergangenheit angewiesen sind, nicht adäquat gestaltet werden.

